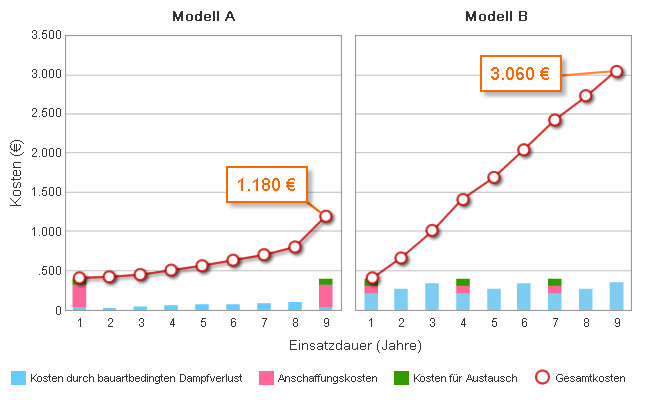- Home
- Dampftechnik und Tools
- Dampftechnik
- Auswahl von Kondensatableitern: Sicherheitsfaktor und Lebenszykluskosten
Grundlagen Kondensatableiter
Auswahl von Kondensatableitern: Sicherheitsfaktor und Lebenszykluskosten
In den vorangegangenen Abschnitten ging es hauptsächlich um physikalische Zusammenhänge als Auswahlkriterien, während sich dieser Teil mit dem Sicherheitsfaktor und den Lebenszykluskosten befasst.
Was versteht man unter Sicherheitsfaktor?
Der Sicherheitsfaktor ist ein Zuschlag bei der Ermittlung der benötigten Durchsatzleistung. Er bewirkt einen gewissen Puffer für den Fall, dass die tatsächlich anfallende Kondensatmenge die ursprünglich berechnete oder angenommene Menge übersteigt. Der zugrunde gelegte Kondensatanfall sollte für die Auslegung des Kondensatableiters immer mit dem empfohlenen Sicherheitsfaktor multipliziert werden.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, wie die Kondensatableiterbauart den Sicherheitsfaktor beeinflusst:
| TLV-Kondensatableitertyp | Minimal empfohlener Sicherheitsfaktor |
|---|---|
| Schwimmer-Kondensatableiter | 1,5 |
| Glockenschwimmer-Kondensatableiter | 2 |
| Thermodynamischer Kondensatableiter | 2 |
| Thermischer Kapsel-Kondensatableiter (mit X-Element) | 2 |
| Bimetall-Kondensatableiter | 3 bis 5 |
Der Sicherheitsfaktor wird von mindestens zwei Faktoren bestimmt: Der Spitzenlast und der bauartbedingten Reaktionszeit auf veränderten Kondensatanfall.
Spitzenlast
Die Spitzenlast, d.h der maximale Kondensatanfall in einem Dampfverbraucher, kann aus mehreren Gründen deutlich höher sein als die durchschnittlich anfallende Menge. Beim Anfahren ist das Material des Dampfverbrauchers selbst noch kalt, so dass zunächst mehr Kondensat anfällt als im stationären Betrieb. Bei Batchprozessen ist das Produkt zu Beginn einer Charge am kältesten. Entsprechend ist der Wärmefluss und damit der Kondensatanfall am Anfang überdurchschnittlich groß.
Wenn bei der Leitungsentwässerung ein Kondensatableiter blockiert, fließt das Kondensat bis zur nächsten Entwässerungsstelle, wo der Kondensatableiter nun die doppelte Kondensatmenge ableiten muss.
Die Größe des Sicherheitsfaktors
Die von Herstellern empfohlenen Sicherheitsfaktoren können von 1,5 bis 5,0 reichen, je nach Kondensatableiterbauart, Zuverlässigkeit von Durchsatzangaben, erwartetem Verschleiß des Ventilsitzes, Wichtigkeit der Anwendung usw.
Die auf Datenblättern wiedergegebenen Durchsatzwerte gehen von einer kontinuierlichen Entwässerung aus. Manche Bauarten wie Glockenschwimmer- und Thermodynamische Kondensatableiter haben jedoch eine zyklische Arbeitsweise, so dass für diese ein größerer Sicherheitsfaktor benötigt wird, um Kondensatrückstau zwischen den Arbeitszyklen zu vermeiden.
Darüber hinaus rechnen manche Hersteller mit größeren Sicherheitsfaktoren, damit letztendlich größere Ventilsitze zu Einsatz kommen, die weniger leicht verstopfen. Im Vergleich dazu wird für kontinuierlich arbeitende Kondenssatableiter, wie zuverlässig ausgelegte Schwimmer-Kondensatableiter, meistens nur ein Sicherheitsfaktor von 1,5 benötigt.
Der Sicherheitsfaktor kann auch nützlich sein, wenn z.B. aufgrund eines erhöhten Kondensatgegendrucks der Differenzdruck geringer ausfällt als erwartet und damit die Durchsatzleistung verringert wird.
Bei der Auslegung des Kondensatableiters ist es daher sehr wichtig, zum ermittelten Kondensatanfall den empfohlenen Sicherheitszuschlag hinzuzurechnen, damit die Durchsatzleistung auch tatsächlich ausreicht.
Lebenszykluskosten des Kondensatableiters
Kondenstableiter sind ein wichtiges Bauteil in einer Dampfanlage und sollten gemäß ihrer Lebenszykluskosten ausgewählt werden, um langfristig einen kostengünstigen Betrieb zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die Anschaffungskosten nur ein untergeordnetes Entscheidungskriterium bei der Auswahl sein sollten. Wichtiger sind auf lange Sicht die Kosten für Wartung, Installation und Austausch sowie die Verlustkosten durch funktionsbedingten Dampfverlust und Leckage.
Ein hoher Verschleiß der Innenteile wie vom Ventilsitz bewirkt mit der Zeit einen zunehmenden Dampfverlust, so dass der Kondensatableiter womöglich vorzeitig ausgetauscht werden muss. Für die Entscheidung, wann ein Kondensatableiter ausgetauscht werden soll, werden meist die Kosten für den Austausch den Verlustkosten durch Leckage oder Betriebsstörungen gegenübergestellt. Darüber hinaus gibt es Kondensatableitertypen, die bauartbedingt zu größeren Leckageverlusten führen als andere. Solche Typen sollten bereits bei der Planung der Dampfanlage ausgeschlossen werden.
| Produkt | Modell A | Model B |
|---|---|---|
| Anschaffungskosten | 300 € | 100 € |
| Kosten für Austausch * | 80 € | 80 € |
| Anfänglicher bauartbedingter Dampfverlust | 0,05 kg/h | 1,0 kg/h |
| Jährliche Zunahme des Dampfverlusts durch Verschleiß | 0,06 kg/h (pro Jahr) | 0,4 kg/h (pro Jahr) |
| Durchschnittliche Standzeit | 8 Jahre | 3 Jahre |
* Basierend auf Mannstunden und Ersatzteile wie Dichtungen usw.
Die Lebenszykluskosten der beiden Kondensatableiter über eine Zeitspanne von 9 Jahren kann berechnet werden. Unter der Annahme, dass beide Ableiter 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr in Betrieb sind und die durchschnittlichen Dampfkosten 20 € pro Tonne betragen, errechnen sich für Modell A die geschätzten Gesamtkosten inklusive Anschaffungskosten und Kosten für den Austausch im Jahr 9 zu 1.180 €. Für Modell B hingegen wären die entsprechenden Gesamtkosten bei Austausch in Jahr 4 und 7 weitaus höher, und zwar 3.060 €. Trotz geringerer Anschaffungskosten für Modell B sind also die Gesamtkosten um Faktor 2,4 höher als für Modell A, wenn man alle Lebenszykluskosten berücksichtigt. Es zeigt sich, wie wichtig bei der Entscheidung für ein Kondensatableitermodell die längerfristigen Kosten sind.
| Lebenszykluskosten von Modell A gegenüber Modell B |
|---|
|
Zuverlässigkeit / Standzeit, Wartungskosten, bauartbedingter Dampfverlust und Leckagedampfverlust sind die wichtigen wirtschaftlichen Kriterien bei der Auswahl des optimalen Kondensatableiters.